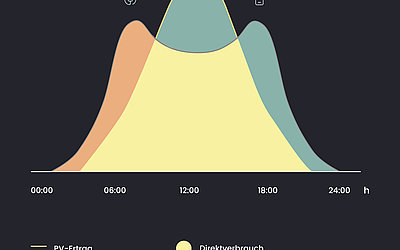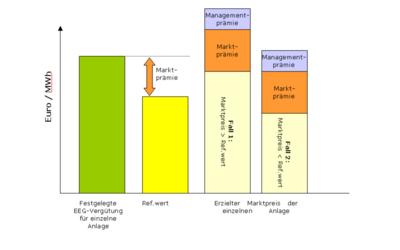So finden Sie die günstigste Solaranlage
EEG-Umlage
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz schreibt vor, dass die Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien von den Stromkunden zu tragen sind. Zu diesem Zweck wurde die EEG-Umlage eingeführt, die als Aufschlag auf den Strompreis erhoben wird und in der Stromrechnung separat ausgewiesen wird.
Deutliche Steigerung der EEG-Umlage seit 2003
Als die EEG-Umlage 2003 eingeführt wurde, betrug sie 0,41 Cent pro Kilowattstunde. Seitdem ist sie in jedem Jahr gestiegen. Im Jahr 2007 wurde mit 1,02 Cent erstmals die Grenze von einem Cent übersprungen. In den folgenden drei Jahren verdoppelte sich die Umlage auf 2,047 Cent. Heute beträgt sie bereits mehr als 5 Cent.
Kostentransparenz als Leitmotiv
Die massive Förderung der erneuerbaren Energien war die zweite große Umstellung der Stromversorgung nach dem Ausbau der Kernenergie. Auch der Ausbau der Kernenergie wurde mit öffentlichen Geldern massiv unterstützt. Die Kosten verteilten sich auf unzählige Einzelhaushalte der Ministerien des Bundes und der Länder. Bis heute kann niemand exakt beziffern, wie hoch die Gesamtkosten genau waren beziehungsweise sind. Bei der Förderung der erneuerbaren Energien entschied sich die Politik daher für einen anderen Weg. Die öffentliche Förderung wird nicht über Steuern finanziert, sondern über die auf den Strompreis aufgeschlagene EEG-Umlage.
Auf diese Weise kann jeder Bürger seinen Kostenbeitrag der Stromrechnung entnehmen. Diese Verlagerung der finanziellen Lasten vom Steuerzahler auf den Stromkunden ist gesamtwirtschaftlich ein Nullsummenspiel, hat jedoch zwei gravierende Auswirkungen. Eher psychologischer Natur ist der Aspekt, dass dadurch jeder Bürger eine Rechnung vorgelegt bekommt und die Mehrbelastungen nicht in irgendwelchen allgemeinen Steuererhöhungen versteckt sind. Sehr real ist hingegen der Effekt, dass keine Lastenverteilung über die Progression der Einkommenssteuer erfolgt.
von Georgia B. aus Malsch
Solar-Experten in Ihrer Nähe finden & kostenlos Angebote anfordern!
SUCHENHat sich die EEG-Umlage bewährt?
Rückblickend kann bezweifelt werden, ob die EEG-Umlage die bessere Alternative zur Finanzierung über Steuermittel war. Insbesondere die automatische Erhöhung der Umlage bei sinkenden Strompreisen hat zu unangenehmen Verzerrungen geführt. Mittlerweile wird diskutiert, einkommensschwache Haushalte bei steigenden Strompreisen aus Steuermitteln zu unterstützen. Es stellt sich die Frage, ob derselbe Effekt nicht unbürokratischer erzielt würde, wenn die Energiewende zumindest teilweise direkt aus Steuermitteln finanziert würde.
Wichtige Änderung im Strompreis: EEG-Umlage entfällt ab 1. Juli 2022 vollständig
Ab dem 1. Juli 2022 entfällt die EEG-Umlage im Strompreis vollständig. Diese Umlage betrug bislang 3,72 Cent je Kilowattstunde und wurde nun auf null abgesenkt.
Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck begründete, bereits seit Monaten sei der Druck auf die Energiepreise enorm, daher ist der Wegfall der EEG-Umlage eine wichtige Nachricht für Verbraucher und Unternehmen. Der Bundesrat hatte bereits am 20. Mai 2022 endgültig beschlossen, die EEG-Umlage auf null abzusenken. Im Energiewirtschaftsrecht wurde gleichzeitig sichergestellt, dass diese Absenkung im zweiten Halbjahr 2022 beim Endkunden tatsächlich ankommt. Die Stromlieferanten sind daher verpflichtet, die Preise zum 1. Juli 2022 entsprechend anzupassen.
Die Auswirkungen dieser Änderung sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher erheblich. Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh zahlte im Jahr 2021 noch 227,50 Euro für die EEG-Umlage. Aufgrund der Absenkung im Jahr 2022 werden es über das Jahr gerechnet nur noch 65 Euro sein. Ab 2023 entfällt die Umlage dann vollständig, was weitere Entlastungen für die Stromverbraucher mit sich bringt.
Letzte Aktualisierung: 24.07.2023